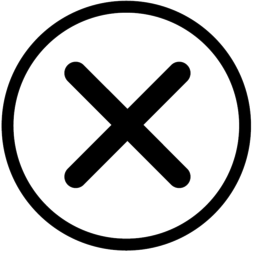Einleitung
Sobald in einer Therapie von Geträumtem berichtet wird, ist man von dessen regulativen Bedeutsamkeit überzeugt: von einer intuitiven Weisheit der erlebten Bildlichkeit. Traumszenen lassen sich — wie Riten oder Zeremonien — als Akte mit Symbolcharakter verstehen: Handlungen, denen eine über die bloße Geste hinausgehende Bedeutung innewohnt. Auch alltägliche Gewohnheiten, Bräuche und Feierlichkeiten aber auch ritualisierte Zwänge oder sogenannte Ticks können Symbolisierungen darstellen.
Ein Fallbeispiel: ein Klient, der einen Waschzwang entwickelt hatte, wollte — sprichwörtlich — um alles in der Welt „sauber“ bleiben. Symbolisch stand hier der Schmutz an sich für „dreckige“ Gedanken und „schmutzige“ Gefühle. Beides galt es in ihrer erlebten Obszönität und Peinlichkeit wegzuwaschen. Die dahinter liegende Metaphorik zu durchschauen, spielte für die kathartische Wirksamkeit der Symbolhandlung keinerlei Rolle. Entscheidend war einfach die Tatsache, dass sich die rituelle Pragmatik der körperlichen Reinigung für den Klienten ganz praktisch nutzen ließe: er erlebte sich tatsächlich innerlich reiner. — In der Therapie kristallisierte sich heraus, dass es zweckmäßiger war, die Träume meines Klienten jenseits von Rationalität und Logik zu bearbeiten. Dabei stellte sich mir die Frage: Wie kann ich als Psychotherapeut vorgehen, um im Traum nicht nur nach Sinn und Bedeutung zu suchen, sondern Geträumtes als Ausdruck vitaler Regulierungskräfte erfahrbar zu machen?
Das Konzept der Traumkompetenz
Hinter meinem Ziel ein psychotherapeutisches Handbuch zur Traumarbeit zu verfassen, steht eine Vision. Mit dem Verfahren der Dialogischen Traumtherapie möchte ich dazu beitragen, die Lebensqualität von Menschen durch Stärkung sogenannter Traumkompetenzen zu verbessern.
Das Phänomen des Träumens lässt sich weiter fassen als ein schlafendes Mysterium, das sich orakelhaft ausdrückt. Traumarbeit ist mehr als unseren traumhaften Bewusstseinsrausch möglichst lebensnah zu interpretieren. Jeder Nachttraum entfaltet in uns vitale Kompetenzen, die auch im Wachleben genutzt werden sollten — insbesondere von Menschen, denen es eher nicht mehr möglich erscheint, Leidenszustände und Probleme alleine oder durch Unterstützung von Partner, Familie oder Freunden zu bewältigen.
Wer „Professionalisten der Seele“ wie Psychologen, Psychiater oder Psychotherapeuten aufsucht, hat immer sinnvolle Gründe, die diesen Schritt rechtfertigen. Träume fachlich auslegen zu lassen, kann hilfreich sein, um etwa mit Depressionen, Burnout, Ängsten oder Krisen gut umgehen zu können. Aber auch die allgemeine Verbesserung von Lebensqualität oder eine wertneutrale Unterstützung bei Entscheidungsprozessen können therapeutische Ziele sein. Dazu können Traumbilder in einen sinnvollen Zusammenhang mit dem eigenen Lebensalltag gerückt werden. Geträumtes hinsichtlich aktueller Herausforderungen auslegen zu versuchen, ist bloß eine Variante therapeutischer Traumarbeit.
Im Traumschlaf entfalten sich unsere produktiven Gestaltungskräfte mühelos. Sie manifestieren sich primär in zwei zusammengehörigen Ressourcen: 1) unsere Fähigkeit zum Visionieren und 2) unsere Befähigung zum Verwirklichen. Beide sogenannten Traumkompetenzen repräsentieren Pole menschlicher Vitalität, die auch in Psychotherapie substanziell sind.
Wer etwas verwirklichen und gestaltet möchte, versucht bestimmte Zielvorstellungen und Zukunftsbilder zu konkretisieren: wir visionieren Möglichkeiten und beabsichtigte Wirklichkeiten, um Vorhaben besser umsetzen zu können. Unser Talent zeigt sich in Bewusstseinszuständen, in denen Motivation kreiert wird. Die Psychologie spricht von sogenannten Motiven, um Kräfte zu beschreiben, die unsere emotionalen, kognitiven und körperlichen Anstrengungen steuern. Wünsche, Sehnsüchte, Anliegen, Antreiber oder Intentionen können uns willentlich aber auch ungewollt motivieren. Unser Ansporn, etwas zu wollen, kann verschiedenste Beweggründe haben. Wir benötigen jedenfalls Motive und Motivation, um ambitionierte Vorhaben zu erreichen. Vereinfacht könnte man von einem zielorientierten Tagträumen sprechen. Dabei werden Visionen für das künftige Leben imaginiert. Wir nützen unser Vorstellungsvermögen, um mentale und emotionale Attraktoren zu schaffen: Zukunftsbilder, die einem in ihrer vorausschauenden Attraktivität „zu sich hin ziehen“ (wie der lateinische Ausdruck ad trahere es anschaulich darlegt). Wer etwa die Liebe seines Lebens gefunden hat, spricht von der vielzitierten „Frau meiner Träume“. — Zündende Ideen entspringen ebenso unserer Einbildungskraft, wenn auch „Geistesblitze“ und originelle Einfälle weniger planbar sind als im linear-kreativen Phantasieren von Zielsetzungen.
Unsere subjektive Erlebensrealität stellt eine „Ich-will“-Wirklichkeit dar: Bedürfnisse, Begierden, Sehnsüchte und Wünsche bestimmen unser Verhalten. Wer etwas möchte, bewegt sich zwischen Erfahrungen von Selbstvertrauen und Skepsis: „Ich bin, was ich will!“, brachte Erik H. Erikson (1902 - 1994) unsere identitätsbildenden Willensanstrengungen auf eine Formel. Vor allem Kleinkinder im Alter von zwei bis drei Jahren werden davon angetrieben. Zunehmend treten später eigene Lebensvisionen in den Fokus: „Ich bin, was ich mir vorstellen kann zu werden!“ Wer sich seine Zukunft ausmalt, bewegt sich zwischen Entschlusskraft und Ungewissheiten. Man entwirft sein Leben in einem Netzwerk aus Kausalitätsverknüpfungen, die Naturgesetzen und sozialen Logiken folgen — ganz nach dem Motto: wenn ich A tue, wird B geschehen.
Im Unterschied dazu präsentiert sich die Traumwirklichkeit als eine mehr oder weniger irrationale „Es-passiert“-Welt. Träume scheinen ihren eigenen Regeln und Gesetzmäßigkeiten zu folgen. Im Schlaf verändert sich nämlich die synaptische Chemie unseres Gehirns. Unter anderem wird ein Neurotransmitter namens Acethylcholin ausgeschüttet, um die Körpermotorik zerebral zu blockieren. Träumend reduzieren sich die Aktivitäten unseres dorsolateralen präfrontalen Kortex, zuständig für sogenannte Ich-Gefühle und Willensfunktionen. Auffällig verändern sich unsere Selbstwahrnehmung und Lebensabsichten im REM-Schlaf. In Träumen können sich bei Gelegenheit gegenwärtige Anliegen bemerkbar machen. Traumbilder nähren sich aus erlebten Erfahrungen und ersehnten Wünschen. Doch weniger der Träumende selbst scheint etwas zu wollen: vielmehr wird auf das Geträumte reagiert. Sigmund Freud sah im Traum einen „Hüter des Schlafes“: Träume schützen uns vor Grundbedürfnissen, die auch für den schlafenden Organismus real sind. Wer beispielsweise fastet und mit nichts im Magen zu Bett ging, könnte von einem mehrgängigen Menü träumen. Vom Essen träumend lässt es sich mit hungrigem Bauch in Ruhe weiterschlafen. —
Schreiten wir zur Tat!
Im Wachleben fordert die traumaffine Seite des Visionierens eine pragmatische Dimension: das aktive Verwirklichen des Beabsichtigten. Mit anderen Worten: wir planen nicht nur, sondern nützen munter unsere Lebensressourcen, um Pläne umzusetzen. Mit einem Baumeister, der bloß plant ohne zu bauen, wird niemand eine Freude haben. Außerdem eignet man sich Strategien an, um persönliche Ziele erreichen zu können. Sogar rhetorisch brillante Politiker müssen Ergebnisse vorweisen, seien diese auch weniger brillant. Und wer ein verständliches Buch schreiben will, muss seine Einfälle möglichst verständlich zu Papier bringen. Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) formulierte es so: „Es ist nicht genug, zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug, zu wollen, man muß auch tun.“ Ansonsten gilt man als Träumer, Tagträumer, Traumtänzer, „jemand, der seinen Kopf in den Wolken trägt“ oder „Spinner, der in Luftschlössern lebt“ — bestenfalls hält man uns für Visionäre oder Idealisten. Motivierte Menschen können voller Elan, Energie und Schwung strotzen. Wer jedoch zu übermotiviert ist, kann auch über das Ziel hinausschießen.
Schlafend müssen wir uns weder Dinge vorstellen noch Masterpläne schmieden und deren Umsetzung bewerkstelligen. Unser Traumbewusstsein erschafft problemlos ganze Universen: die geträumte Welt verwirklicht sich — wortwörtlich — im Schlaf. Ohne die geringste Mühe vereint Geträumtes beide Pole: detailgenaue Vorstellungsgabe und vollkommene Gestaltungsexpertise. In der Realität gestaltet sich der Einsatz beider Kompetenzen herausfordernder. Gute Ideen zu haben, ist in verzwickten Situationen zu wenig. Einfälle, Wunschvorstellungen oder Planvorhaben erweisen sich erst nützlich, wenn man es tatsächlich schafft, diese im Dasein auch umzusetzen. Ein Fallbeispiel: eine Klientin hatte unter ihrer Wohnsituation gelitten und sich nach einem Traumhaus gesehnt. Sie konnte ihre Vision vom schönen Wohnen bereits ein Stückchen Wirklichkeit werden lassen, indem ein Bausparvertrag abschlossen wurde. — Kredite können eine praktische Währung des Verwirklichens darstellen. Mit Geld lassen sich bestimmte Wirklichkeitswünsche und materielle Lebensträume in die Realgegenwart tauschen. Geldinstitute aber auch Glücksspiel-Gesellschaften machen sich diese vielversprechende Werbebotschaft zu nutze: „Egal, ob kleine oder größere Träume — wir helfen Ihnen, sie zu verwirklichen!“ (Bank Austria) oder „Alles ist möglich!“ (Österreichische Lotterien).
Nicht immer gelingt es, die persönliche Wunschliste in die Realität umzusetzen. Sorge, Kummer und Verzweiflung könnten als leidvoll erlebte Differenzwahrnehmungen charakterisiert werden: zwischen ersehnten Lebensentwürfen und Erfahrungen von lebensgeschichtlichem Versagen und biografischem Scheitern. Niederlagen des Alltags werden im Kontext einer Leistungs- und Risikogesellschaft unvermeidlich als „eigener Verdienst“ gewertet. Wir kennen zahlreiche Bilder, um einen erlittenen Misserfolg auszudrücken: baden gehen, ein Schlag ins Wasser oder ins Leere, Schiffbruch erleiden, eine Bauchlandung hinlegen, aufs Kreuz fallen, auf den Bauch oder Hintern fallen, auf die Nase oder Schnauze fallen, sich eine blutige Nase oder kalte Füße holen, ein Griff in die Kloschüssel, ein Schuss in den Ofen, sein Waterloo erleben, …
Der psychotherapeutische Auftrag kann sein, Klienten dabei zu unterstützen, mit eigenen Misserfolgserlebnissen wohlwollender umzugehen. Der Dialog über geträumte Lebenswelten — selbst über eher feindselige — wird zum Katalysator der Psyche. Einerseits geht es im Austausch darum, mit der innerlichen Atmosphäre des Klienten in Resonanz zu kommen. Andererseits sollen mittels Trauminterviews eigene Schuldzuweisungen relativierbar werden. Selbstbezichtigungen, nicht „stark“ oder „gut“ genug zu sein, oder ich-feindliche Glaubenssätze werden wie Tellermienen in der Seele entschärft: durch traumbildlich-gestützte Ritualarbeit oder die narrative Implementierung neuer Sprachbilder in der Lebensgeschichte: Metaphern, die ein möglichst ich-freundliches Klima erzeugen. Therapeutisches Ziel ist es, sich selbst wieder verantwortungsvoll begegnen zu können und realistisch optimistisch in die Zukunft zu sehen.
Dialogische Traumtherapie versucht Traumkompetenzen von Klienten zu verorten, zu begünstigen, zu unterstützen, zu trainieren. Dazu wird das richtungsweisende Vorstellungsvermögen sowie das gestalterische Kapital gefördert. In nächtlichen Träumen scheinen unsere schöpferischen Kräfte allgegenwärtig. Kreativität oszilliert zwischen beiden Begabungen: dem Etwas-bildlich-vor-sich-sehen und dem Etwas-in-die-Tat-umsetzen. In der Psychotherapie können sowohl Visionsqualitäten als auch Realisierungsfähigkeiten lokalisiert, entwickelt, eingeübt werden: mittels Traumdialog, über traumverwandte Bewusstseinszustände (wie Trance oder Imaginationsübungen), durch Verkörperungen und Körperwahrnehmungsübungen.
Sich einer höheren Vision verpflichtet fühlen
Eine weitere Traumkompetenz kann hilfreich sein, um Wandlungsprozesse therapeutisch zu begünstigen: sogenanntes Transzendieren. Aufschlussreich ist dazu die Bedeutung des lateinischen Begriffs transire: hinübergehen, überschreiten. „Damit das Leben etwas bedeutet“, brachte es Joseph Campbell (1904 - 1987) auf den Punkt, „müssen wir das Ewige berühren.“
Transzendente Erlebnisse lassen sich als visionäre Trancezustände beschreiben, die über persönliche Zielgrenzen hinausgehen. Wir überschreiten dabei gewohnte Erfahrungswelten. Dies kann zu Erkenntnissen führen, die mentale Transformationen bewirken. Erinnern wir uns an die Wandlung von Saulus zu Paulus: Paulus von Tarsus hatte in Damaskus eine Vision des auferstandenen Jesus, die aus dem Christenverfolger einen verfolgten Apostel machte. Psychiatrisch könnte man dem Verfasser des berühmten „Römerbriefes“ im Neuen Testament eine einmalig auftretende „akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie“ (kurz: F23.1) diagnostizieren. Hierbei treten Halluzinationen, Wahnphänomene und Wahrnehmungsstörungen auf. — „Bekehrungserlebnisse“ oder Persönlichkeitsveränderungen müssen nicht immer so dramatisch geschehen. Transformierende Transzendenzerlebnisse können in viel kleinerer Dosis erfahrbar werden: etwa im Gebet, in der Mediation, in Trancereisen oder sogenannten Kontemplationen (wie beim Betrachten von Kunstwerken oder beim Lauschen von Musik).
Es ist völlig normal, wenn wir in Nachtträumen natürliche Begrenzungen hinter uns lassen. Träumend werden Naturgesetze wie selbstverständlich außer Kraft gesetzt. Ein Traumbeispiel: ein Klient mit schweren Depressionen träumt von einem Engel — eine Lichtgestalt wie hinter strahlendem Milchglas. Weder ist ein Gesicht zu erkennen noch wird ein Wort gesprochen. Der bloße Anblick des Engel gibt dem Traum-Ich viel Kraft. Gestärkt geht es im Traum zu einer Frau, die offensichtlich Suizid begehen will. Sie kauert am Dachboden eines heruntergekommenen Schuppens, direkt neben der Dachluke. Zentimeter trennen sie von der Tiefe. Der Mann geht zur Frau hin, beugt sich zu ihr und legt eine Handfläche stärkend auf ihren Rücken. Danach steht er auf und verlässt mit einem befreienden Gefühl den Schuppen. Am Ende des Traumes überlässt der Träumer seiner weiblichen Traumgestalt die Entscheidung über Leben oder Nicht-Leben. Als der Klient aufgewacht war, fühlte er sich innerlich sehr gestärkt — obwohl er in jener Traumnacht relativ wenig geschlafen hatte.
Es müssen nicht unbedingt Engel und Theophanien sein, oder überirdische Botschaften verkündet werden. Träume, Visionen aber auch Sinnestäuschungen und Halluzinationen können uns in ihrer Surrealität überraschen bis schockieren: immer unterbrechen sie alltäglich gebräuchliche Gedanken-, Gefühls- und Verhaltensmuster. Intensive Transzendenz setzt — wie eine Psychose — alle gewohnten Routinen außer Kraft. In Traum- und Wachzuständen entsteht transzendentes Erleben im Großen und Ganzen, wenn gewöhnliche Erfahrungszustände durch intensivere Erlebnisse abgelöst werden. Dabei können Grenzüberschreitungen am eigenen Leib erfahrbar werden: eine Erfahrung von transzendenter Lebendigkeit wird gemacht. Ein Traum kann dazu ein übernatürliches Bild inszenieren, als würde er das Leben wie von einem „übernatürlichen“ Standpunkt aus umgestaltet wollen. Es können aber auch ironische oder schaurige Traumszenen sein, die Routinen des Alltags im Schlaf surreal durchbrechen. Ein Traumbeispiel: eine Klientin mit Angststörungen hatte von ihrem Ehemann geträumt. Er rammt ihr im Traum eine Spritze ins linke Auge. Vor Schmerz betäubt wachte sie auf. — Viele Albträume setzen Alltagsmuster außer Kraft, manche unterbrechen sogar die Schlafroutine.
Dialogische Traumtherapie nützt unsere nächtlichen Erfahrungen des Unheimlichen, Ungewöhnlichen, Unrealistischen oder Überirdischen. Besonders das Übersinnliche und Geheimnisvolle fesseln unsere Aufmerksamkeit. Hier geht es darum, bisherige Bezugssysteme sensibel „auszuhebeln“, um Klienten neuartige Erkenntnisse zu ermöglichen. Man könnte von Mikroprozessen der Transformation sprechen, die auf sozialer, psychischer und sogar biologischer Ebene stattfinden. — Transzendente Erlebnisse ermöglichen uns, das eigene Leben auf neufältige, vielfältigere Weise zu erfassen. Sie entfalten vitale Glaubenserfahrungen in Form von neuer Lebensklarheit, neuem Selbstvertrauen, neuer Zuversicht und neuen Hoffnungen. Und damit erleichtert sich der Einsatz von Fähigkeiten und Potentialen, die in Klienten bereits existieren, aber noch nicht (hinreichend) genutzt werden. Eigene Kompetenzen können aufgrund psychosozialer Leidenszustände und Problemfixierungen ausgeblendet sein oder durch fehlende Übung und mangelnde Vergegenwärtigung unterentwickelt bleiben. Psychotherapeutisch werden „realitätsfremde“, befremdende Traumerlebnisse genützt, um neue Erfahrungen von Lebendigkeit und Vitalität zu erlauben.
Die pragmatische, ergebnisbezogene Dimension von Transzendenz zeigt sich in unserer Kompetenz des Engagierens. Sie verfügt genauso über eine zielfokussierte und eine wirklichkeitsorientierte Seite. Dabei verpflichtet man sich einer höheren Vision, die als Teil persönlicher Zielsetzungen erlebt wird. In positiven Utopien werden gesellschaftliche Neuentwürfe visionär ausgelotet, um möglichst ideelle Lebensbedingungen zu ermöglichen. Grob gesagt ist die Utopie ein Lebenstraum von der besseren Welt — im Gegensatz zur sogenannten Dystopie, die der Menschheit eine pessimistische Zukunft ausmalt. In höchstem Grad engagierten sich etwa Martin Luther King, Mohandas Karamchand Gandhi oder Jesus von Nazareth, letzterer verbürgt unpolitisch: Jesus heilte, verkündigte Gottes Liebe und die Botschaft der Auferstehung. Und indirekt gestalten Jesus Christus, Siddhartha Gautama (Buddha), Abū l-Qāsim Muhammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muttalib ibn Hāschim ibn ʿAbd Manāf al-Quraschī (Mohammed) oder Mose vom Stamm Levi unsere Welt und die Menschheit bis Heute mit. Die Weltreligionen engagieren sich für Liebe, Erkenntnis und Ordnung — wobei der destruktive Eifer religiös-krimineller Extremisten eher einer dystopischen Albtraumkompetenz gleichkommt.
Wer sich bereitwillig für eine „höhere“ Sache starkmacht, will nur bedingt persönliche Bedürfnisse stillen. Die Traumkompetenz im weiten Feld von Engagement verfolgt die aktive Verwirklichung von überindividuellen, gesellschaftlichen, sozialpolitischen oder spirituellen Visionen. Man will einem größeren Ziel dienen und kann dazu bereit sein, über persönliche Begrenzungen hinauszugehen, ja, sich sogar selbst zu opfern. Es geht dabei weniger um die subjektive Suche nach einem Lebenssinn als um das Erfahrbarmachen eines kollektiven Lebendigseins.
Traumrausch versus Narrativlogik
Die letzten beiden Traumkompetenzen, die ich anführen möchte, ließen sich mit dem dionysischen und apollinischen Prinzip vergleichen. Friedrich Wilhelm Schelling (1775 - 1854) hatte das polare Begriffspaar vorgestellt, populär gemacht wurde es von Friedrich Nietzsche (1844 - 1900). Damit werden zwei weitere traumartige Erfahrungsqualitäten beschrieben, deren gegensätzlichen Eigenschaften in der griechischen Mythologie personifiziert sind: von Dionysos, dem Gott des Weines (und der Trauben, der Freude, der Fruchtbarkeit, des Wahnsinns und der Ekstase) und Apollon, Gott des Lichts (und des Frühlings, der Heilung, der sittlichen Reinheit und Mäßigung sowie der Weissagung und der Künste, insbesondere der Musik, des Gesangs und der Dichtung).
Das Dionysische versinnbildlicht die menschliche Fähigkeit zum Irrationalen, Sinnlichen, Triebhaften, Rauschhaften, Ekstatischen, Lust- und Schmerzvollen: ein Mystifizieren, das sich auch im rauschartigen Traumerleben der Nacht ausdrückt. Träumen ist ein psychoaktiver Vorgang, der die alltägliche Wirklichkeit wie hinter einem Schleier des Rätselhaften verhüllt. Alles, was wir im Geträumten erleben, scheinen unergründliche Verfilmungen mentaler Verfassungen. Im Traum wird der herkömmlich reflektierende Modus des Verstandes leiser gedreht, auf Stand-by geschalten oder gänzlich ausgeknipst. Überspitzt formuliert ein vernunftwidriger Zustand: man durchlebt intensive Erfahrungen, scheint im traumhaften Getriebensein aber kaum etwas zu begreifen. Wie in einem Drogenrausch aus inneren Bildern handelt man zumeist etwas konfus und verwirrt. Tabus können dabei fallen und wir feiern mit bislang inakzeptablen Gefühlen und verdrängten Gedanken regelrechte Orgien.
Dagegen zeigt sich das Apollinische im Ordnungsprinzip zum rationalen Verstehen, zur logischen Erkenntnis und zum vernünftigen Ergründen von Phänomenen. Hier repräsentiert sich die Traumkompetenz des Mythologisierens: unsere Fähigkeit, erlebte Wirklichkeit in sogenannte Mythen oder Mythologien zu übersetzen. Im mythischen oder mythologischen Begreifen der Welt wird versucht, Erfahrungen und Sachverhalte in Relationen und Zusammenhänge zu bringen — egal ob man wahre Lebensberichte erläutert, ein Märchen erzählt oder Witze macht, oder ob wir in der Nacht träumen und das Geträumte zu deuten versuchen. Als einziges Lebewesen kann der Mensch als narratives Geschöpf beschrieben werden. Wir beantworten Fragen des Menschseins als erzählende Individuen. Mittels Geschichten versucht man, das eigene Tun sowie Handlungen anderer zu erklären. Wir beziehen darin Stellung zu allzumenschlichen Fragestellungen, um ein Was-kann-ich wissen?, ein Was-soll ich tun?, ein Was-darf-ich-hoffen? und ein Was-ist-der Mensch? zu ergründen.
In nächtlichen Träumen artikuliert sich eine schlafwandlerische Form unseres erzählerischen Könnens. Häufig ersetzt der Traum die narrative Kausalität durch sogenannte Koinzidenzerzählungen. Scheinbar wahllos werden Zusammenhänge her- und dargestellt sowie Kausalketten durchbrochen. Träumend wird unsere Lebensrealität wie in einem grotesken Spiegel zersplittert. In ihrem „Antiplot“ wirken Träume oft absurd und sinnlos. Ein Traumbeispiel: eine Klientin träumt von einer lebensgroßen Kuh aus Kunststoff, die sich am Grazer Hauptplatz befindet. Darin verstecken sich Polizisten. Auf einmal steht das Haustier mit zwei Rädern vor dem Stephansdom in Wien. Nun wird es vom Vater der Klientin als Motorrad benutzt. Damit fährt er von Wien nach Graz zurück. —
Trauminterpretationen sind eine erweiterte Narrationsgestalt im Mythologisieren. Im psychotherapeutischen Kontext wird gewöhnlich versucht, aus der Nichtlinearität eines Traumes einen möglichst linearen Archeplot zu generieren: eine kausale Erzählung, die nach Möglichkeit konsistente Realitäten der Lebenwelt reflektiert. So werden Metaerzählungen über das zu verändernde Leben elaboriert. Therapeutisch gedeutete Träume sind narrative Sinnbildungen, die von Klienten und Psychotherapeuten gemeinsam konstruiert werden. Wie in einer Privatmythologie handeln darin mehr oder weniger aktive Protagonisten mit inneren und äußeren Konflikten.
Auch die Filmindustrie und der Buchmarkt leben von unserem lebenswichtigen Talent der Narration — selbst wenn Autoren oder Regisseure mittels empirischer Beweisführung überzeugen möchten. Hollywood beschäftigt viele Meister der Traumkompetenz des Mythologisierens. Im Kino werden unterhaltsame Storys erzählt, um möglichst lukrativ Welt- und Lebensbeziehungen herzustellen. „Wir sind vom gleichen Stoff, aus dem die Träume sind“, lautet eines der berühmtesten Zitate von William Shakespeare (1564 - 1616). Theater und Filmkunst scheinen besonders fähig, uns Erkenntnisse über das Leben traumhaft zu vermitteln.
Wer jedoch vom „Baum der Erkenntnis“ naschen will, muss den „Baum des Lebens“ hinter sich lassen. Dies scheint der Preis zu sein, um „Gott und die Welt“ sortieren, präzisieren, erklären, verstehen zu versuchen: wer Dynamiken des eigenen Lebens differenzieren und begreifen will, muss sich in gewisse reflektierende Distanz dazu begeben. Die dionysische, irrationale Maxime muss zurücktreten, damit Raum für das apollinische, rationale Prinzip entstehen kann. Ohne Frage kann es auf der Suche nach Lösungsideen hilfreich sein, Personen im Therapiesessel über Aspekte des Lebensalltag mit gesunden Abstand zum Tagesgeschäft nachsinnen zu lassen. Dazu gehört auch das kognitive Bestreben, Geträumtes in Bezug zum Wacherleben zu bringen. — Da viel eher unangenehme Träume in Erinnerung bleiben, würdigt das Besprechen von verstörenden oder erschreckenden Traummetaphern zuallererst ein Problemerleben des Träumers. „Mitträumend“ kommt der Psychotherapeut in unmittelbare Resonanz, zumal drastische Bilder uns viel direkter betroffen machen. Aber nicht nur im Traum erfahren wir, dass ein Bild mehr sagt als tausend Worte. Die Umgangssprache nützt den Mehrwert von Metaphern am laufenden Band und in einer Tour. Sprachbilder machen Gedanken und Gefühle anschaulicher, deutlicher, lebendiger: so können wir mit unseren Gedanken ringen, sie bekämpfen und besiegen, oder ein Wechselbad der Gefühle erleben und von ihnen überschwemmt werden.
Psychotherapeutisch und traumtherapeutisch macht es Sinn, Klienten in ein emotionales Erleben oder körperliches Spüren zu bringen. Werden die Gefühlszustände eines Traumes bewusst wertgeschätzt und anerkannt, können etwa bislang ausgeschlossene Affekte oder noch unbeachtete Wünsche ins Bewusstsein gebracht werden. — Sogenannte Abwehrmechanismen müssen dabei nicht „psychoanalysiert“ werden. Träume stellen weniger eine „Widerstandszensur“ dar, wie Sigmund Freud (1856 - 1939) behauptete. Eher sprechen sie unangenehme Wahrheiten in ihrer Bildlichkeit unverhohlen aus.
Strukturen der Restrukturierung des Lebens
Psychotherapie soll beides ermöglichen: die Erfahrung von existenzieller, kommunikativer und sozialer Verbundenheit sowie das Erleben von Ich-Autonomie, Entscheidungskraft, Unterscheidungskompetenz und Erkenntnisfähigkeit. Therapeutische Handlungen dienen — wie Rituale — immer Lebensprinzipien. Sie entfachen „Bilder der Seele im Leben des Menschen“ und begleiten Übergänge. Dabei werden psychosoziale Operationen moderiert, moduliert oder modelliert. Riten begünstigen Heilung, Schutz, Wiedergutmachung, Versöhnung, Reinigung, Abschiednehmen, Eingliederung oder Lebensveränderungen. — Veränderungen können im Laufe des Lebens in zahlreichen Zustandsformen auftreten. Um einige zu nennen: Änderung, Abänderung, Anpassung, Modifikation, Erneuerung, Neuordnung, Neuregelung, Reform, Reorganisation, Umbildung, Umgestaltung, Tapetenwechsel, Auffrischung, Renovierung, Restaurierung, Wiederherstellung, Reparatur, Weiterentwicklung, Revolution, Revision, Wandlung, Abwandlung, Umwandlung, Verwandlung, Metamorphose, Mutation, Transformation, …
Das Ritual lässt sich grundsätzlich charakterisieren: als „geplante oder improvisierte Performance, die eine Überleitung des alltäglichen Lebens in einen alternativen Zusammenhang (bewirkt), in dem der Alltag transformiert wird“. Es betont primär zwei Qualitäten: die dramatische Struktur im Aktivsein von Ausführenden oder Zeugenschaft und den dynamischen Aspekt einer Wandlung. Riten, geprägt von Kultur und jeweiliger Gesellschaftsordnung, versuchen unseren Lebensalltag mehr oder weniger zu restrukturieren. Zu diesem Zweck machen sie sich unsere Traumkompetenzen zunutze. Ein paar Beispiele: man begibt sich etwa auf rituelle Visionssuche (Visionieren), setzt Trennungen durch Abschiedsrituale um oder realisiert den „Bund fürs Leben“ in Hochzeiten (Verwirklichen), beschwört göttliche Kräfte in Vergebens-, Erlösungs- und Befreiungsriten (Transzendieren), verpflichtet sich in Bekenntnisritualen zu selbstlosen Einsätzen (Engagieren), treibt mittels Rauchpraktiken „böse Geister“ aus (Mystifizieren) oder zelebriert Bettgeh-Zeremonien, wenn wir Kindern zum Schlafengehen ein Märchen vorlesen (Mythologisieren). —
Im Gegensatz zum naturgemäß einsamen Vorgang des nächtlichen Träumens werden Rituale und Zeremonielle zumeist in Anwesenheit einer Zeugenschaft vollzogen, damit Veränderungsprozesse nicht nur vom betroffenen Individuum allein wahrgenommen werden. Auf dass persönliche Veränderung wirklich Lebenswirklichkeit werden kann, muss sie auch vom sozialen Umfeld anerkannt werden. Erkennbare Veränderungen betreffen im Alltag schließlich nicht eine einzelne Persönlichkeit, sondern immer auch jene Personen, die ihr nahestehen. Im psychotherapeutischen Kontext wird der Psychotherapeut zum bedeutungsvollsten Zeugen. Er identifiziert Aggregatzustände der Veränderung beim Klienten. Eine fundamentale Aufgabe von Therapeuten ist hier die Rückmeldung: darüber, woran man merken kann, dass etwas geschafft wurde, dass etwas gelungen ist, dass sich etwas verändert hat.
Träume können Seismographen für Veränderung sein. Eine Traumerinnerung kann Notwendigkeiten und Stoßrichtungen für Lebensveränderungen signalisieren. Gerade Geträumtes, das in Psychotherapie thematisiert wird, wirkt wie ein mentaler Erschütterungsanzeiger für innere und äußere Beben. Und intensive Emotionen führen sofort zu einer Reaktion — vor jeder Kognition. Die Richterskala des Träumens klassifiziert sich in Metaphern, aus denen Erkenntnisse und Informationen über versinnbildlichte Änderungs-, Wandlungs- oder Transformationsprozesse gewonnen werden!

Abbildung 1: „Traumkompetenzen“
Dialogische Traumtherapie nützt — wie das vitale Spektrum menschlicher Ausdrucksweisen — unsere Traumkompetenzen in allen Qualitäten. Voll entwickelt gewähren sie die Grundlage für Lebenszufriedenheit, -freude und -lust. Die Erlebensdimensionen dafür werden in der Bildmitte nach ihrer Priorität aufgezählt.